Kurz und knapp – darum geht’s
Ein harmloser Fund löst in einer norddeutschen Kleinstadt panische Reaktionen aus: Als der Rentner Otto Fintzel beim Renovieren seines Dachbodens einen Koffer seines verstorbenen Nazi-Bruders entdeckt und davon im Männergesangverein „Germania“ erzählt, geraten seine Sangesbrüder in Aufruhr. Jeder von ihnen fürchtet, dass der ungeöffnete Koffer belastende Dokumente aus der NS-Zeit enthalten könnte, die ihre sorgsam verborgene Vergangenheit ans Licht bringen. Als einer der verzweifelten Tenöre bei dem Versuch, den Koffer zu stehlen, tödlich verunglückt, beginnt Kommissar Horst Greve aus Lübeck undercover im Chor zu ermitteln. Als die Wahrheit über den mysteriösen Koffer schließlich ans Licht kommt, muss sich die Kleinstadt-Gemeinschaft mit ihren verdrängten Schuldgefühlen auseinandersetzen…
Inhalt der Tatort-Folge „Das Zittern der Tenöre“
Durch die nebelverhangenen Straßen der verschlafenen Kleinstadt Endwarden hallt das mehrstimmige Singen des örtlichen Männerchors „Germania“. Im gedimmten Licht des Übungsraums, wo der Geruch von Bier und Zigaretten in der Luft hängt, sitzen die betagten Herren in trauter Runde beisammen. Der gutmütige Rentner Otto Fintzel erzählt seinen Freunden aufgeregt von seinem Fund auf dem Dachboden – einem alten Lederkoffer seines 1944 gefallenen Bruders Julius, der ein überzeugter Nazi und leidenschaftlicher Sammler war.
Was als harmlose Anekdote beginnt, lässt die Mienen der Sangesbrüder plötzlich erstarren. Der Oberstudienrat Rainer Buchholz, der Apotheker Walter Hanke und der Wirt Klaus Möhlmann tauschen bedeutungsvolle Blicke aus. „Den Koffer machst du am besten gar nicht erst auf“, rät einer der Männer mit kaum verhüllter Nervosität. Doch Fintzel ist zu neugierig.
In der kleinstädtischen Idylle, wo jeder jeden kennt und die Fassaden stets makellos gestrichen sind, verbirgt sich ein dunkles Kapitel. Wie Schatten aus der Vergangenheit lasten die nicht aufgearbeiteten Kriegsjahre auf den Männern. Untermalt vom rhythmischen Ticken der alten Wanduhr im Probenraum keimen Ängste auf – der Lehrer fürchtet um seine bevorstehende Beförderung, der Apotheker um den guten Ruf seiner Tochter, die Stadträtin ist. Ihre Vergangenheit gleicht einem sorgsam verschnürten Paket, das nun aufzubrechen droht.
„’Lass die alten Geschichten ruhen'“, beschwört der Apotheker seinen Freund Fintzel, „’nichts Gutes kommt dabei heraus, wenn man in der Vergangenheit wühlt.'“ Doch da ist es bereits zu spät.
In einer stürmischen Nacht dringt Oberstudienrat Buchholz in Fintzels Haus ein, um den Koffer zu entwenden, und trifft dort auf den Wirt Möhlmann, der dieselbe Absicht verfolgt. Im Handgemenge stürzt Möhlmann die knarrende Holztreppe hinunter – tödliche Stille folgt.
Der Fall landet auf dem Schreibtisch des Lübecker Kriminalhauptkommissars Horst Greve. Mit seiner ruhigen, zurückhaltenden Art beschließt er, undercover zu ermitteln. Wie ein Fremder aus einer anderen Welt betritt er die geschlossene Gemeinschaft des Chores, gibt sich als alter Freund des Verstorbenen aus und bittet um Aufnahme in den Gesangverein. Sein Vorsingen gerät allerdings zur Katastrophe. „Der singt wie ’ne Gießkanne“, urteilt Apotheker Hanke abfällig.
Während der Proben beobachtet Greve mit scharfem Blick, wie die Chorbrüder beim gemeinsamen Singen eine trügerische Harmonie vorspielen. Die Atmosphäre im Raum gleicht einem überspannten Seil, das kurz vor dem Reißen steht. Bei zunehmender Weinseligkeit nach der Probe stimmen die Männer bereitwillig alte Kampflieder an – eine nostalgische Zeitreise, die das wahre Gesicht hinter den bürgerlichen Masken zeigt.
Die Fahndung nach der Wahrheit gleicht dem Versuch, in einem Sumpf aus Verdrängung und Selbsttäuschung festen Boden zu finden. Als schließlich ein von Hermann Kroll engagierter Einbrecher den Koffer stehlen will, schlägt Greve zu. Der entscheidende Moment naht, als der Kommissar beim nächsten Treffen des Gesangvereins auftaucht – mit dem mysteriösen Koffer in der Hand…
Hinter den Kulissen
Der Tatort „Das Zittern der Tenöre“ ist eine NDR-Produktion aus dem Jahr 1981 und der erste und einzige Fall des Lübecker Kriminalhauptkommissars Horst Greve, dargestellt von Erik Schumann. Gedreht wurde vom Spätherbst 1980 bis Frühjahr 1981 im Kreis Herzogtum Lauenburg, wobei vor allem Motive aus den Orten Geesthacht und Trittau erkennbar sind. Die fiktive Kleinstadt Endwarden wird durch Autos mit RZ-Kennzeichen (Kreis Herzogtum Lauenburg) verortet, während Kommissar Greve mit seinem Lübecker Dienstwagen (HL-Kennzeichen) anreist.
Für die authentische Atmosphäre der Chorszenen sorgte der echte Gesangverein „Germania“ aus Hamburg-Finkenwerder, während das Platzkonzert im Film vom Geesthachter Blasorchester von 1960 gespielt wurde. Eine besondere Besetzung ist der Komponist Peter Janssens, der normalerweise im Bereich der geistlichen Musik tätig war und hier die Rolle des Chorleiters Fiedler übernahm.
Die Vorlage zum Film lieferte der Roman „Das Zittern der Tenöre“ des Kriminalschriftstellers Hansjörg Martin, dessen Werk vom Regisseur Hans Dieter Schwarze adaptiert wurde. Schwarze hatte bereits eine frühere Martin-Verfilmung, „Der Fall Geisterbahn„, inszeniert. Im Gegensatz zur Buchvorlage nimmt der Film eine entscheidende Änderung vor: Während der Kommissar im Roman von Anfang an Teil der Dorfgemeinschaft ist, kommt er im Film als Außenseiter nach Endwarden.
Der Film wurde am 31. Mai 1981 zum ersten Mal in der ARD ausgestrahlt und erreichte mit rund 15 Millionen Zuschauern eine beachtliche Einschaltquote von 44%. „Das Zittern der Tenöre“ reihte sich damit in die damals typischen NDR-Tatorte ein, bei denen das gesellschaftliche Thema – hier die Verdrängung der NS-Vergangenheit – im Vordergrund stand, während die Ermittlerfigur eher eine Nebenrolle spielte.
In der öffentlichen Rezeption wurde der Film unterschiedlich bewertet: Während einige Kritiker die „präzise Handwerksarbeit“ und die „intelligent reduzierte“ Erzählweise lobten, bemängelten andere die aus ihrer Sicht zu oberflächliche Behandlung des komplexen Themas der Vergangenheitsbewältigung. Bemerkenswert ist die Entstehungszeit des Films kurz vor der von Bundeskanzler Helmut Kohl 1982 proklamierten „geistig-moralischen Wende“ und einige Jahre vor dem Höhepunkt des Historikerstreits – der Tatort griff damit ein Thema auf, das bald darauf die gesellschaftliche Debatte in Deutschland bestimmen sollte.















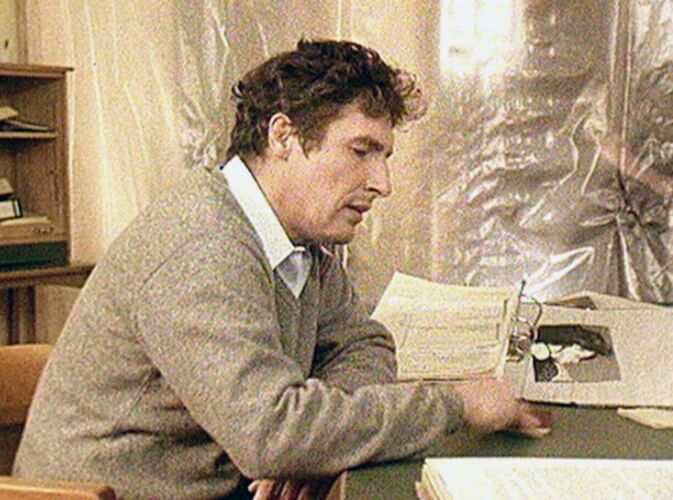



Die alten „Tatort“-Krimis sind noch immer sehenswert, jedenfalls einige, z. B. „Reifezeugnis“ von 1977 oder eben die vor ein paar Wochen ausgestrahlte Folge „Das Zittern der Tenöre“: Sie war spannend, hatte (fast heute noch) einen brisanten zeitgeschichtlichen Bezug – und kam ohne zur Schau gestellte Gewalt aus.
Solche Krimis möchte man öfter sehen (ein Tipp an die Fernsehsender und ihre preiswerten, wertvollen ‚Konserven‘ in ihrer ‚Asservatenkammer‘).
A. Maurer
Der Tatort Nummer 125. Ein Hauptkommissar Greve aus Lübeck ermittelt in einer dörflichen Mittelstandsburg. Was meint der da herausfinden zu können. Ja, wenig in dieser Zeit. Diesen Tatort habe ich tatsächlich in Erstsendung gesehen und nun zum zweiten Mal. Das Kopfschütteln über diese Langweiligkeit ist geblieben, damals wie heute. Die Jungs im Fernsehfilm sollten wohl den Wechsel von Generationen aufzeigen, total daneben. Die Youngtimer fehlten, wahrscheinlich schon in den Pups der Großstädte geflüchtet. Die damaligen Gegebenheiten in diesen Ortschaften kannte ich persönlich, hatte Freunde und Bekannte dort. Dieser Tatort hätte 15 bis 20 Jahre früher spielen können. Aber in den 80zigern?? Den Mittelstands-Rekord, den KHK Greve im Tatort fuhr, den hatte der Vater eines damaligen Freundes auch. Der war Chemiefacharbeiter in einer Großstadt und verlieh seinen Wagen auch an seinen Sohnemann.
Mwah, trotz gute Besatzung leider etwas schwach.
War sehr Kammerspiel-artig. Ich schaue mir so alte Folgen nur selten an (und noch seltener, ohne die ‚Schnelllauf-Taste‘ zu drücken …). Es gab damals nur wenige – für mich – sehenswerte Folgen, absolutes Highlight der Zeit 1970-1999 (also aus dem letzten Jahrtausend!) ist aus meiner Sicht ‚Peggy hat Angst‘.
Oft hat damals der Mut gefehlt, problematische Themen ‚explizit‘ zu zeigen: hier etwa das ‚Nazi-thema‘! Zwar wurde hier ein ’sexueller Übergriff‘ (an der Küchenhilfe) gezeigt, aber doch sehr verharmlosend (‚hätte sie sich weniger aufreizend anziehen sollen‘).
Bekanntlich gefällt mir die große Bandbreite, die durch die TO’s von 1970 bis jetzt abgebildet wird.
–> wenig überraschend gefallen mir TO’s aus den letzten ca. 15 Jahren – insbes. auch wegen der besseren HD-Bildqualität – um vieles besser!
Der Tatort mit der Nummer 125 aus Lübeck und aus dem Schicksalsjahr 1981. Der wird alle paar Jahre erstaunlich und weise wiederholt.
Meine Meinung vom 06.10.2015 halte ich.
Mangels Wertungssystem muß ich mir die Sterne hier selbst machen: ⭐️⭐️⭐️
@Der Fremde
Die Bildqualität war doch ganz ordentlich im Vergleich zu manchen Haferkamp-Folgen!
Und ich liebe die alten Schinken! Besser als vieles, was heute so geboten wird – Bildqualität hin oder her!
Nach fast zwei Monaten jedenfalls mal wieder ein TO-Oldie jünger als Jg. 1995 resp. unter Nr. 300! Warum davor keiner aus dieser Zeitspanne gesendet wurde, ist rätselhaft: der letzte war ‚Zärtlichkeit des Monsters‘ am 8. März 2023.
Und der NDR kastriert zum wiederholten Male den Abspann, wahrlich keine Meisterleistung!
Na ja, in der Mediathek-Version ist er aber vorhanden, womit der 150. der 300 ersten TOe im privaten Archiv gesichtet & gesichert ist – die restlichen 150 werd‘ ich bei dieser miesen Programmplanung wohl mein‘ Lebtag nicht mehr schaffen!
Diese Folge lief letztmalig im Jahre 2008, nun passend zum Termin „8. Mai“, dem Jahrestag der sog. „Befreiung“ vulgo Kriegsende. Sie ist Gegenstand einiger wissenschaftlicher Untersuchungen zur Zeitgeschichte, z.B. in „Vergangenheitsbewältigung im Tatort? NS-Bezüge in der ARD-Krimireihe“ von Christian Hißnauer (Repositorium Medienkulturforschung, Berlin 07/2014, S. 7ff) und bei Michael Mandelartz „Der ‚Tatort‘ und die Grenzen des Rechts. Der Fernsehkrimi als Ritual und als Kunst“ (Meiji-Universität, Tokio 2009, S. 16ff).
Darüberhinaus findet auch ‚Pension Tosca oder Die Sterne lügen nicht‘ (BR 1987) Erwähnung, eine mit 114 Min. Spieldauer ungewöhnlich lange Ost-Spionagegeschichte mit einem Ermittler namens Karl Scherrer, dargestellt von Hans Brenner – die wäre übrigens auch mal eine Wiederholung wert, liebe Programmplaner!
Neben Erik Schumann, auch als Synchron- und Hörspielsprecher bekannt, agieren zahlreiche TO-Protagonisten: Paul Edwin Roth aus ‚Kassensturz‘, Heinz Schimmelpfennig war 8x Kommissar Gerber in Baden-Baden, Georg Lehn (Kurzschluß), Hans Hessling (Kressin u.d. tote Mann m Fleet) und Hans Beerhenke, der häufig bei Haferkamp zu sehen ist.
Dazu Elisabeth Wiedemann (Herzversagen), Joost Siedhoff (u.a. Freund Gregor), Udo Thomer (zuvor Der gelbe Unterrock & Mit nackten Füßen), Kay Sabban (7x u.a. Trimmel und Isolde & Finale am Rothenbaum) und Zacharias Preen (Zweierlei Blut) als Erpresserjüngling – und wer ‚Reifezeugnis‘ aufmerksam beobachtet hat, dem wird die Küchenhilfe (Sabine Burgert) bekannt vorkommen!
Sie ist eine Mitschülerin von Sina/Nastassja Kinski und sitzt in der Klasse neben ihr, die Rolle dort ist allerdings „sprachlos“.
Trotz des beachtlichen Aufgebots an ausgezeichneten Darstellern will der Funke jedoch nicht so recht überspringen, was womöglich daran liegt, daß die Vorlage nur in entschärfter Form Umsetzung durch Regisseur Hans Dieter Schwarze (Der Fall Geisterbahn, ebenfalls nach H. J. Martin) fand.
Im Original hat der Dr. Buchholz wesentlich mehr auf dem Kerbholz als nur mit 18 Jahren Lobeshymnen auf den Führer und kriegsverherrlichende Gedichte verfaßt:
Vielmehr ließ er einen jugendlichen Volkssturm-Mann wg. ‚Feigheit vor dem Feind‘ erschießen.
Vielleicht auch deshalb, weil KHK Greve erst nach exakt 57 Min. die Bildfläche betritt, inkognito ermittelt und das Rätsel des Koffers ziemlich banal auflöst: Die Aufklärung, ob der tödliche Treppensturz infolge eines Unfalls selbst- oder fremdverschuldet war, spielt keine Rolle mehr – schließlich war der Zuschauer ja Augenzeuge.
Der ominöse Koffer (vgl. der Kofferinhalt in Quentin Tarantinos ‚Pulp Fiction‘) ist ein schönes Beispiel für einen ‚MacGuffin‘, einst geprägt von Alfred Hitchcock: Irgendein Begriff („Rosebud“ in Orson Welles ‚Citizen Kane‘ z.B.) oder Ding/Objekt, das nur dazu dient, die Handlung voranzutreiben und dem die Akteure hinterherjagen.
In jedem Fall wird schönes Zeitkolorit geboten: Herren trugen noch Hut und Glaswolle wird verbaut – schon damals war Energiesparen angesagt; der kleinbürgerliche Traum des Oberstudienrats Buchholz vom „Fertighaus mit Swimmingpool“.
Opodeldok – kommt das jemandem bekannt vor? Auf dieses Mittel gegen Rheuma schwörte schon weiland Jaroslav Hašeks braver Soldat Schweijk!
Bester Spruch: „Erst noch fix ein‘ vergiftet, was Walter?“ – Stimme aus dem Chor zum Apotheker Hanke.
Zum guten Schluß die harten Fakten:
Die Musik komponierte Peter Janssens, der den Chorleiter spielt; Drehorte sind Lübeck, das fiktive Endwarden (wg. der RZ-Kennzeichen irgendwo im lauenburgischen Kreisherzogtum zu verorten), und in Trittau die Mühle.